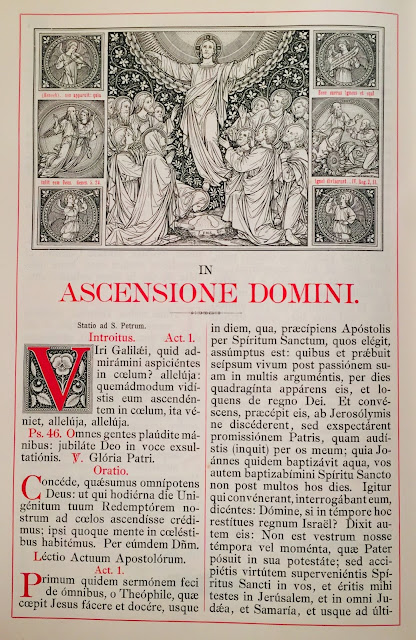Das neue Herrentum
"Hallo, ich bin der Herr Meier*!"
(*Die Namen sind natürlich ausgetauscht und fiktiv.)
So schallt es mir freudig entgegen.
Ein junger Mann, so Anfang Zwanzig, hatte sich mit mir zu einem seelsorglichen Gespräch verabredet. Nun lernen wir uns kennen.
Ich zögere und kann meine ersten Gedankenimpulse trotz dieser strahlenden Begrüßung nicht ganz einordnen. Zum einen freue ich mich, daß ein junger Mensch meinen Dienst als Seelsorger in Anspruch nehmen will. Zum anderen stimmt aber an der Begrüßung etwas nicht. Drei Punkte fallen mir sofort auf.
Da ist dieses ungezwungene "Hallo", mit dem man nun schon überall in vertraulicher Weise begrüßt wird, genauso wie ein unverbindliches "Tschüß" zum Abschied.
Leicht, fluffig, nichtssagend.
Dann der bestimmte Artikel "der". Jeder Mensch müßte doch eigentlich wissen, daß Eigennamen determiniert sind und (allgemein) keines Artikels bedürfen! "Ich bin die Uschi", "Das ist der Thomas", wie falsch hört sich das an und ist doch mittlerweile fast Standard in der Umgangssprache — vielleicht, so muß ich zugeben, sollte ich meinen Grammatikduden von 1959, der mir bislang gute Dienste geleistet hat, doch mal ersetzen …
Was mich aber am meisten irritiert, ist die Selbsttitulation.
Früher (wann das auch immer war) galt: Der Mann nennt sich selbst niemals "Herr".
Wie kernig klang ein "Guten Tag, mein Name ist Schmidt"! Längst vergessen.
Überall nun kommt es mir entgegen, am Fernsprecher "Hallo, hier ist Herr Schulze", per E-Mail "... Mit freundlichen Grüßen, Herr Ostrowski", selbst auf dem Namensschild des Supermarktmitarbeiters: "Herr Klose".
Lauter selbstbewußte Herren sind hier im Kommunikationsdschungel unterwegs.
Sind nun wirklich alle Männer gleichzeitig Herren? Und wo bleiben die Diener? Einen Herren gibt es doch nur, wenn es auch Diener gibt. Genauso kann es nicht nur Häuptlinge geben ohne Indianer, oder nicht?
Wie wohltuend bescheiden habe ich den Brauch bei den Trappisten in der Abtei Mariawald kennengelernt, bei dem sich ein Mönchspriester im Schriftverkehr als „fr. N.“ tituliert. Frater, also Bruder. Nicht Pater. Eine Form der Selbstdemütigung.
Und auch beim alten Hertling lesen wir ähnliches: "Als Unterschrift schreibt man seinen Namen ohne Titel, in gewöhnlicher Schrift, höchstens etwas größer und deutlicher. Sich eine schwungvolle Unterschrift mit Schnörkeln und Faxen angewöhnen, ist lächerlich. Ebenso wenn man den Namen mit der Feder möglichst unleserlich schreibt und darunter mit Maschinenschrift die Entzifferung. Das soll so aussehen, als ob man fünf Sekretäre beschäftigte und täglich Hunderte von Unterschriften zu geben hätte" (Ludwig Hertling S.J., Priesterliche Umgangsformen, Innsbruck 1930) -- dieser Ratgeber ist übrigens auch heute noch, mit gewissen Modifikationen, allen Priestern wärmstens zu empfehlen.
Ist nicht die katholische Liturgie ein wundervolles Zeugnis dieser bewußt gewählten Selbsterniedrigung und Zurücknahme?
Kommt es auch hier dem Zelebranten gegenüber zu ehrfürchtigen Anreden ("Segne, hochwürdiger Vater" oder sogar "hochwürdigster Vater" bei höheren Prälaten), so ist ein bestimmter Titel tabu, die kulturgeschichtlich älteste Anrede an einen Höherstehenden: nämlich "Dominus", "Herr".
Warum tabu? Der Dominus in der Hl. Schrift und in den liturgischen Texten ist Gott selbst, nur er ist der Herr. Kein Mensch wird also im Kult so angesprochen. Daher gibt es in der Liturgie eine lateinische Kunstform für Sterbliche. Statt "Dominus" wird der Priester nun mit "Domnus" angeredet. Das herausgebrochene "i" soll den seinsmäßigen Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf deutlich machen. Also: "Jube, Domne, benedicere", "Herr, gib den Segen", so bittet der Ministrant nach der Hl. Messe in der Sakristei.
Und wieder einmal bestätigt es sich, was der äthiopische Prinz Asfa-Wossen Asserate so schon in seiner wundervollen Sozialstudie über die deutsch-europäischen Umgangsformen geschrieben hatte: "Wie bereits erwähnt, ist nach der Überzeugung des französischen Moralisten Joubert die eigentliche Schule der Manieren die Liturgie, und man könnte mühelos darlegen, wie sich aus dem liturgischen Dienst der lateinischen und griechischen Kirche die wesentlichen Formen der Ehrfurcht und des Respekts ableiten lassen, die in den europäischen Manieren so lange bestimmend waren"(Asfa-Wossen Asserate, Manieren, Frankfurt a. M. 2003, S. 112).
Gewiß wollte sich der junge Mann, mit dem ich verabredet war, nicht bewußt herausputzen, erhöhen, wichtigtun. Und so ist mir bald meinen ersten Gedanken zum Trotz ein Rat des äthiopischen Prinzen in den Sinn gekommen: Wer anfängt, anderen schlechte oder falsche Umgangsformen vorzuhalten, hat selbst längst den Boden guter Manieren verlassen.
Übrigens, bei Frauen war es immer anders. Weil im Umgang mit Frauen eben immer irgendwie alles anders ist oder war. Damen hatten den Vorzug, sich selbst mit Frau N. zu bezeichnen, eigentlich aber mußten sie sich nie selbst vorstellen, sondern wurden vorgestellt. Wo das ausblieb, mußten sie nicht einmal gegenüber Herren Ihren Namen nennen. Diese Regeln sind heute natürlich fürchterlich verstaubt. Die selbstbewußte Dame übernimmt heute auch mal die Restaurantrechnung, braucht keine Hilfe, um ihren Mantel überzuziehen und muß auch nicht mehr zwangsweise die Gaststätte hinter dem Mann betreten. Aber das ist eine andere Geschichte …